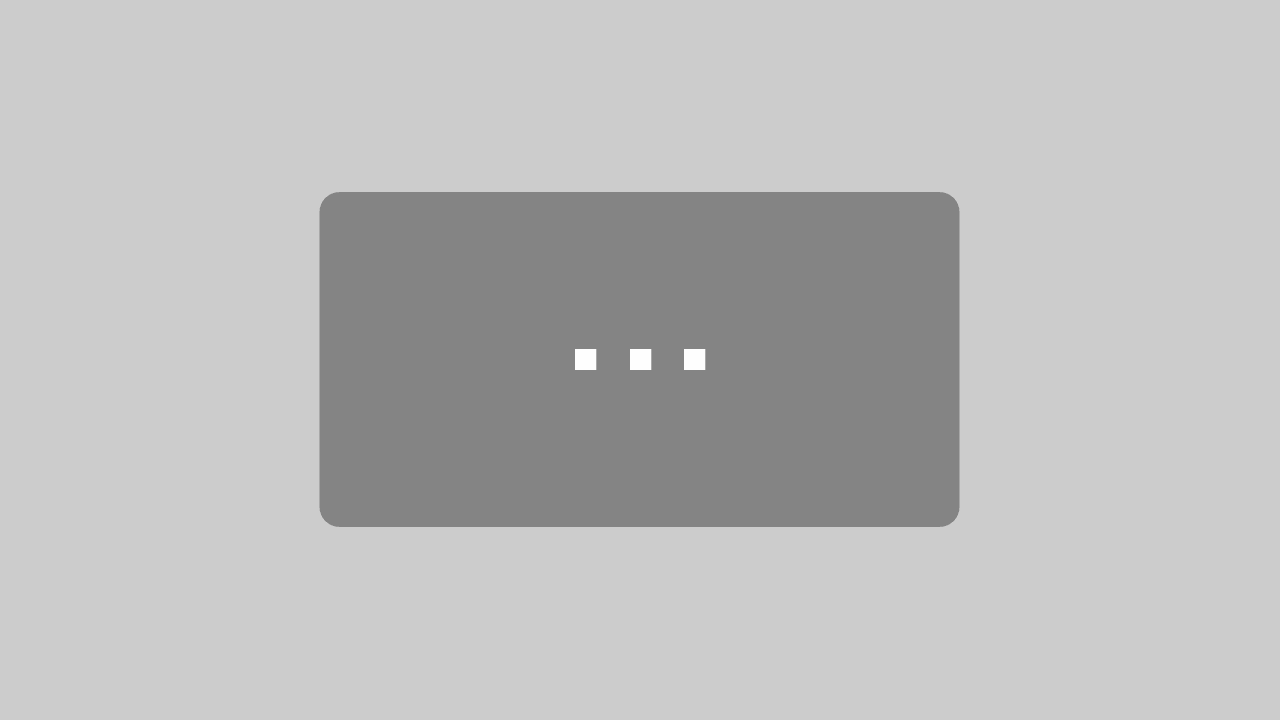Wir Menschen verstehen die Welt manchmal besser durch Symbole. Und so ist es nicht verwunderlich, dass auch die Religionen der Welt ihren Kerngedanken in Symbolen aus. Ein Beispiel wäre das Rad als Symbol der ewigen Wiederkehr oder der Weg / Labyrinth als Symbol der Lebensgeschichte, der Lebensführung und des Lebensweges. Zu den bekannten christlichen Symbolen zählen das Kreuz, das Christusmonogramm, das Lamm Gottes (Agnus Dei), der Fisch und das Buchstabenpaar Alpha und Omega.
Die Auferstehung Jesu war und ist für die Christen oftmals schwer zu verstehen und da können Auferstehungssymbole mit ihrer bildhaften Sprache schon sehr hilfreich sein. Zum Beispiel finden wir in der Tierwelt bestimmte Tiere, die in einen Zusammenhang mit der Auferstehung von Jesu stehen bzw. den auferstandenen Christus symbolisieren.
Da wäre zum Beispiel der Löwe. Schon seine äußeres wirkt ja majestätisch und königlich und ist nicht Christus der ewige König? Der Löwe hat einen ausdrucksstarken Blick – fast menschliche Gesichtszüge, die sehr gerecht wirken. Und ist nicht Christus der gerechte Richter? Löwe blickt schlau und hat Gott nicht Christus alle Weisheit offenbart? Ja und darum ist nicht verwunderlich, dass der Löwe eben auch für Christus den König steht. Sicher: Der Löwe ist gefährlich, aber irgendwie wirkt ein Löwe, der Schatten eines Baumes ruht, auch sanftmütig. Der Löwe gilt als König der Tiere der Erde – dieses Bild ist uns ja auch aus dem Musical „König der Löwen“ bekannt.
Schauen wir mal weiter: Der Löwe ist ein weitverbreitetes Symbol-Tier in vielen Mythologien. Meist wird ihm eine sonnenhafte Bedeutung, also ein enger Bezug zum Licht, zu geschrieben. A-HA! Gedanken zusammenführen: Löwe = Licht & Jesus= Licht der Welt! Das ist also schon mal verständlich. Übrings, die sonnenhaft-lichtvolle Bedeutung des Löwen geht auf seine strahlen-artige Mähne und die Farbe seines Fells zurück.
Aber schauen wir im nächsten Schritt mal tiefer oder besser mal in die Bibel rein!
In der Bibel finden oder hören wir häufig vom Löwen – u.a. im Buch der Psalmen. Der Stamm Juda wird im Alten Testament mit einem Löwen verglichen. Und jetzt kommt eine entscheiden Stelle im Neuen Testament in der Offenbarung, die uns weiterführt: Dort wird Jesus als Löwe von Juda beschreiben. Im 5. Kapitel im Vers 5 der Offenbarung des Johannes steht geschrieben: „Weine nicht! Siehe, gesiegt hat der Löwe aus dem Stamm Juda, der Spross aus der Wurzel Davids.“ Diesen Vers singen wir Mönch in der Vesper der Osterzeit oft als Antiphone (Kehrvers). Bedingt durch diese Bibelstelle sahen und sehen die Christen im Löwen ein Symbol für den auferstandenen Christus, der über den Tod, wie ein Löwe übers eine Beute, gesiegt hat. Ein starkes Hoffnungsbild. Da gibt es einen Löwen für uns – Jesus – der für uns kämpft, damit wir leben. Wow, stärker geht es nicht. Mit Jesus Christus haben wir haben einen kraftvollen Löwen an unserer Seite!
Auf dem Portal unserer Abteikirche ist ein Löwe mit Krone abgebildet. Dieser Löwe zertritt mit seiner Pranke eine hässliche Fratze mit Krone: Der obengenannte Vers aus der Offenbarung wird dargestellt! Christus, der Löwe von Juda, zertritt den Tod. Durch die Auferstehung Jesus hat der Tod seine Macht verloren und darum dürfen wir jubeln und uns freuen. Wir müssen nicht mehr weinen, denn gesiegt hat unser Löwe von Juda! Halleluja!
(Br. Benedikt Müller OSB)