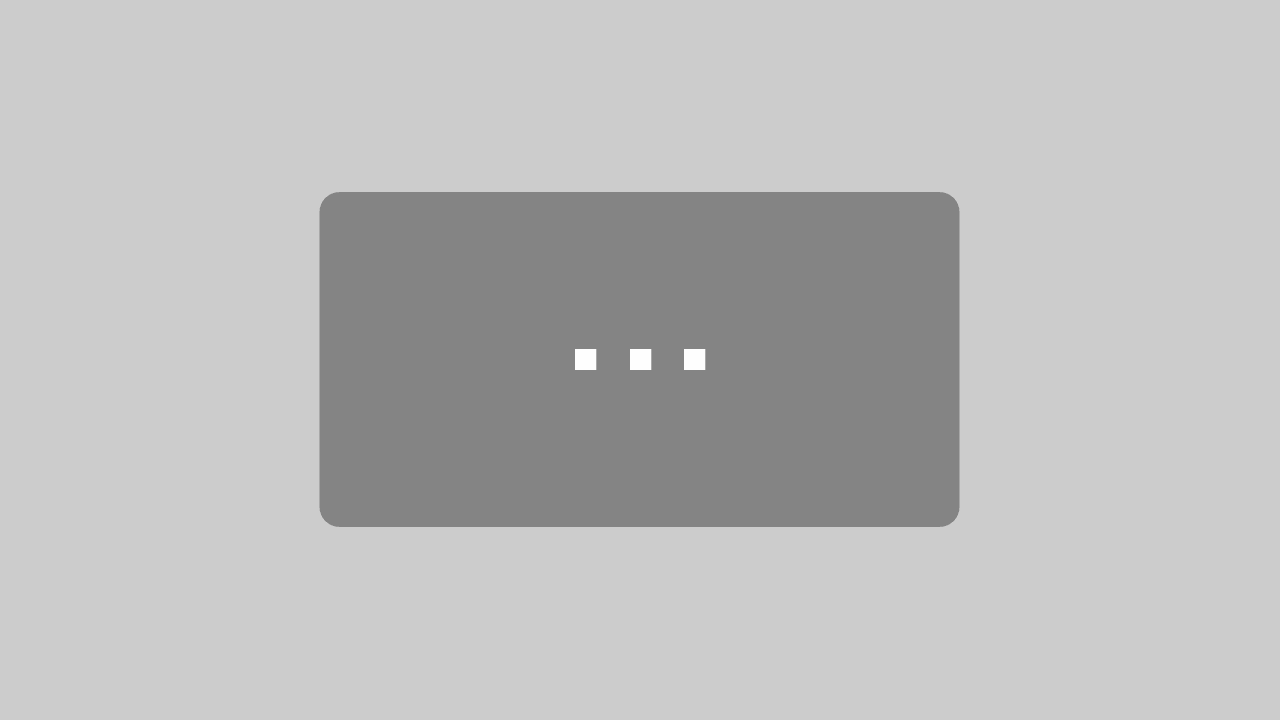Gestern haben wir in den Kloster.Welten das Fest der hl. Scholastika gefeiert. Feste mit ihren Traditionen durchbrechen den grauen Alltag und bringen Farbe in unser Leben. Ihr kennt das sicher aus Eurem Alltag, wenn Geburtstage anstehen oder das Weihnachtsfest mit seinen eignen Familientraditionen zu Hause gefeiert wird. Tradition ist es an Festtagen oftmals, dass wir netten Besuch von Verwandten und Freunden oder Geschwistern bekommen. Im Kloster ist das nicht anders, so z.B. am Fest der hl. Scholastika.
Seit vielen Jahren ist es eigentlich so, dass wir Mönche von Königsmünster uns auf den Weg zu unseren Schwestern – den Nonnen der Abtei Varensell / Rietberg – machen. Hintergrund zu diesem Besuch ist, dass der hl. Benedikt sich einmal im Jahr mit seiner Schwester Scholastika traf. Ich erinnere mich an viele schöne, gemeinsame Scholastikafeste in der Abtei Varensell. Schon als Postulant (siehe Kloster-ABC) war ich von der tiefen geschwisterlichen Begegnung, und vor allem von der Art wie die Nonne beten, beeindruckt.
In den letzten drei Jahren waren, durch die Pandemie bedingt, diese Besuche leider nicht möglich. Damit aber der rote Faden einer guten Festtradition nicht abreißt, stand in diesem Jahr wieder ein geschwisterlicher Besuch auf dem Programm. Die Äbtissin Angela besuchte mit den Schwestern des Seniorrates der Abtei Varensell heute unser Kloster in Meschede. Das Seniorrat ist das Beratungsgremium für den Abt / die Äbtissin in einem Kloster und besteht aus geborenen und gewählten Mitglieder*innen.
Gemeinsam haben wir uns über die Lage aktuelle unserer Klöster ausgetauscht. Wie sind momentan beiden Gemeinschaften aufgestellt? Welche Themen gibt es? Was steht in der nächsten Zeit an? Wir haben gemeinsam die Mittagshore gebetet und dann im Refektorium das Mittagessen zusammen eingenommen. Es war ein schöner Besuchstag, der den grauen Februartag eine farbige Vorfrühlingsnote verlieh. Eine Begegnung im Geiste der hl. Scholastika und des hl. Benedikt, die beide in unseren Herzen gegenwärtig waren. Kloster.Welten sind wirklich keine langweiligen Welten.
Wenn Du jetzt neugierig auf die Kloster.Welten geworden bist, dann schau Dir doch mal hier auf unserer Homepage das Kloster ABC an. https://oase.koenigsmuenster.de/kloster-welten/
Neben vielen Fotos werden Dir auch klösterliche Begriffe erklärt. Ein toller Einblick in unseren Lebensalltag. Oder besuche doch einmal die Nonnen in Varensell https://www.abtei-varensell.de/ oder uns Mönche in Königsmünster. Dann bekommst Du selber einen persönlichen Einblick in die Kloster.Welten und erfährst, wie es so hinter Klostermauern ist. Einfach: Anklopfen und Hereinspaziert!
Br. Benedikt Müller OSB